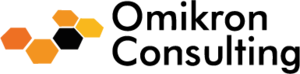Die 5x Warum-Methode (5 Why) ist ein praktisches Werkzeug zur systematischen Ursachenanalyse. Sie fokussiert auf die Wirkungen möglicher Ursachen, um die tiefere Fehlerursache (Root Cause) zu erkennen und eine gezielte, proaktive Lösung zu entwickeln.
Die 5W-Methode ergänzt das Ishikawa-Diagramm sinnvoll. Sie ist einfach, schnell und direkt in der Produktion anwendbar und fördert eine Unternehmenskultur des gezielten Nachfragens.
Vorgehen der 5W-Methode
aufgetretener / entdeckter Fehler
1. „Warum“
direkte Ursache
2. „Warum“
erweiterte Ursache
3. „Warum“
Ursache auf Organisationsebene
4. „Warum“
Ursache auf Systemebene
5. „Warum“
Hauptursache (Root Cause)
Bei der Anwendung sind jedoch 2 Blickrichtungen zu beachten, dies gilt sowohl für das Auftreten des Fehlers / der Ursache, sowie für die Nichtentdeckung des Fehlers / der Ursache. Zu beachten ist des Weiteren, dass es immer eine Ursachenkette gibt.
Anwendung
- z. B. zur Vorbereitung einer FMEA während der Produktentwicklung mittels visueller Darstellung in einem Ishikawa-Diagramm (oder auch Fischgrätendiagramm)
- zur Problemanalyse durch Trennung von Ursache & Wirkung
- ist eine Problemlösungsmethode und die Aufzeichnung dazu ist/sind ein Qualitätsmanagement-Dokument
Unsere Dienstleistung zum Thema:
- 5W Beratung / Unterstützung
- 5W Schulung / Coaching
Die FMEA (Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse) ist eine Qualitätsmethode, die nur mit den richtigen Teilnehmern und systematischer Diskussion über Anforderungen, Funktionen und Fehlerursachen effektiv ist. Ein erfahrener FMEA-Moderator sorgt für zielgerichtete Gespräche und vermeidet Ressourcenverschwendung. Gerne stellen wir Ihnen einen kompetenten Moderator zur Verfügung.
Warum wird die FMEA-Methode eingesetzt?
- Risikobetrachtung während des Produktentwicklungsprozesse, um mögliche Produktfehler, welche in der Nutzungsphase des Produkts auftreten können, zu identifizieren (verursacht während der Produktentwicklung)
- Risikobetrachtung während der Produktprozessentwicklung, um mögliche Prozessfehler, die zu Problemen in der Nutzungsphase führen können, zu identifizieren (verursacht während der Prozessentwicklung)
- Sicherstellung von robusten Produkten und Prozessen
- Das Prinzip der Fehlervermeidung steht im Vordergrund, anstatt später mit viel Aufwand und Kosten korrigieren zu müssen (z.B. Rückrufaktionen, welche unnötig Kosten verursachen und das Image des Unternehmens beschädigen)
FMEA-Arten:
- Produkt-FMEA (Fokus liegt auf der Auslegung des Produkts und dessen mögliche Risiken)
- Prozess-FMEA (Fokus liegt auf dem Herstellprozess und dessen mögliche Risiken)
Mit nachfolgenden Leistungen können wir Sie tatkräftig unterstützen:
- Durchführung von FMEA-Grundlagentrainings für Mitarbeiter und Führungskräfte (nur wenn man versteht was man tut, kann man die Dinge gut tun)
- Durchführung einer Istanalyse bezüglich des derzeitigen Stands zu FMEA-Aktivitäten
- Analyse und Priorisierung von FMEA-Aktivitäten
- Leitung und Moderation von FMEA-Projekten zu ausgewählten Produkten/Prozessen. Hierbei gehen wir wie folgt vor:
- Kick-Off-Meeting mit allen Beteiligten und Feinabstimmung der Vorgehensweise
- Vorbereitung von FMEA-Workshops
- Planung und Einladung von Beteiligten
- Moderation von FMEA-Workshops
- Nachbereitung von FMEA-Workshops
- Maßnahmenverfolgung
- Durchführung von Reviews und Vorstellung von FMEA-Ergebnissen in Ihrer Organisation und bei Ihrem Kunden
- Training und Coaching zukünftiger FMEA-Moderatoren
- Durchführung von FMEA-Audits zur Beurteilung der Effektivität und Effizienz bisheriger Anstrengungen
- Beratung und Unterstützung bei der Implementierung eines zielgerichteten FMEA-Prozesses in der Organisation
- Hilfestellung bei der Auswahl und Integration einer FMEA-Softwarelösung zur Unterstützung und zur Wissensspeicherung
Welcher Nutzen entsteht durch die Inanspruchnahme unserer Leistungen:
- Unsere Fach- und Sozialkompetenz steht sofort zur Verfügung
- Wir schaffen es zielorientiert FMEA's mit den Beteiligten zu erarbeiten
- Wir werden von den Beteiligten schnell akzeptiert und es folgt umgehend eine sachorientierte und zielführende Kommunikation
- Wir können Schwachpunkte schnell erkennen und Verbesserungen anstoßen
- Durch unsere kompetenten Projektleiter sorgen wir für die Einhaltung vorgenommener Projekttermine
Weitere Themen zur FMEA:
- FMEA (Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse)
- Externer FMEA Moderator
- FMEA Beratung / Unterstützung
- FMEA Schulung / Coaching
- FMEA Moderation
QFD (Quality Function Deployment), auch „House of Quality“ genannt, übersetzt Kundenanforderungen mithilfe von Korrelationsmatrizen in technische Produkteigenschaften. Es wird vor Innovationen, bei Neuentwicklungen oder zur Verbesserung bestehender Produkte und Dienstleistungen eingesetzt. Obwohl sich Vorgehensweisen unterscheiden, bleibt das Ziel stets die Erfüllung der Kundenanforderungen.
Definition
Die QFD-Methode wird genutzt um die Kundenanforderungen und Kundenerwartungen in das Unternehmen, bzw. in Produkteigenschaften zu übertragen.
Ziel der QFD-Methodik
Sicherstellung der Kundenanforderungen / Kundenerwartungen
Vorgehen
Zusammenstellen eines geeigneten, interdisziplinären Teams mit Wissensträgern aus verschiedenen Abteilungen
Schritt 1
Ermittlung und Gewichtung der Kundenanforderungen und Kundenerwartungen. Was möchte der Kunde?
Schritt 2
Bewertung und Gewichtung der Erfüllung der Kundenanforderungen durch die Kunden. Und Durchführung eines Benchmarks zu diesen Werten. Warum möchte der Kunde diese Anforderungen haben und wie wichtig sind diese?
Schritt 3
Ermittlung der "Lieferantenvorgaben", Funktionen. Wie werden im Moment die Kundenforderungen umgesetzt (Istzustand)?
Schritt 4
Ermittlung der Zusammenhänge (Korrelation) der Lieferantenvorgaben zu den Kundenforderungen
Schritt 5
Ermittlung der "Konflikte" (Zusammenhänge) der einzelnen Lieferantenvorgaben zueinander
Schritt 6
Ermittlung der Ziel-, Sollwerte zur Verbesserung. Wieviel an Verbesserungen an Funktion, Ausprägung der technischen Eigenschaften sollen umgesetzt werden?
Schritt 7
Gewichtung der Ziel-, Sollwerte zur Verbesserung. Und Durchführung eines Benchmarks zu diesen Werten.
Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse in Produkt-Änderungen, für Neuentwicklungen, KVP-Prozesse
Wichtige Tipps für die Anwendung der QFD:
- Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass die QFD-Methode relativ viel Zeit benötigt
- Die QFD-Methode ist eine Methode die präventiv eingesetzt werden sollte. Wird sie erst begonnen, wenn Entscheidungen schon gefällt sind, ist das wenig hilfreich.
- Die Zusammenstellung des Teams ist ausschlaggebend für den Erfolg
- Um die "Stimme des Kunden" wahrnehmen zu können muss man das "Ohr" am Kunden haben
- Um auf verlässliche Ergebnisse zu kommen muss man die Möglichkeit haben auf eine Zahlen-, Daten- und Fakten-Basis zurückgreifen zu können
- Die Benchmark-Kennwerte sollten ebenso durch Benchmark-Fakten belegbar sein, da sie eine große Auswirkung auf die Ergebnisse haben
- Trotz des ganzen Wissens und der Erfahrung, die man mit in eine QFD einbringt, hat man keine Garantie, dass die Ergebnisse zu dem Erfolg führt, den man sich erhofft
Unsere Dienstleistung zum Thema:
- QFD Beratung / Unterstützung
- QFD Schulung / Coaching
Die Run@Rate Methode hat zum Ziel die Kapazität (Quantität) der Prozessschritte eines Produktes während eines frühen Stadiums im Produktentstehungsprozess gegenüber den Kundenvorgaben (Bedarfen) abzuprüfen. Speziell in der Serienfertigung (z.B. Automobilindustrie) möchte man frühzeitig ermitteln, ob die geplante Hochlaufkurve mit den entsprechenden Stückzahlen von relevanten Lieferanten geleistet werden können.
Geschichtliche Entwicklung
Die Run@Rate Methode wurde ursprünglich von den "Großen Drei" (den 3 großen Automobilherstellern im amerikanischen Raum; GM, Ford, Chrysler) gefordert und basierte auf den Anforderungen der QS-9000 Schriften (APQP). Da man in den VDA-Vorgaben bis zu diesem Zeitpunkt vergeblich nach einer ähnlichen Methode gesucht hat, hat sich die Run@Rate Methode etabliert und ist heute teilweise auch fester Bestandteil in der Lieferantenüberwachung.
Abgrenzung der Methode
Selbstverständlich kann man die Kapazität auch bei internen Prozessen abprüfen. Da die Run@Rate Methode dabei einen einzelnen Prozess oder die aufeinanderfolgende Prozessschritte eines Herstellprozesses eines einzelnen Bauteils beleuchtet, sollte sie deshalb nicht mit dem OEE-Faktor (Overal Equipment Effectiveness) bzw. der (Gesamt-) Anlagenverfügbarkeit verwechselt werden. Es existieren verschiedene Vorlagen der verschiedensten Kunden, die ja nach Vereinbarung, auch zu verwenden sind. Eine einheitliche standardisierte Vorgehensweise oder Vorlage sucht man deshalb vergeblich.
Anwendung der Methode:
Bei der Run@Rate Methode geht es um die Abprüfung, ob die installierten Maschinen, Anlagen und dem eingesetzten Fertigungs-Personal (mit den Anlagenführern, Montagemitarbeitern, usw.) unter Serienbedingungen die vom Kunden geforderte Stückzahl erbringen kann. Bei einem sogenannten Probelauf (Production Trial Run/PTR) wird dabei die tatsächlich hergestellte Stückzahl der geplanten Stückzahl = die vom Kunden beauftragten Bedarfe gegenübergestellt. Dies kann man sowohl mit der absoluten Stückzahl, einem Verhältnis von Anzahl Teile pro Stunde, Tag, Woche, Monat oder Jahr oder der Zyklus-/ Taktzeit darstellen.
Unsere Dienstleistung zum Thema:
- Run@Rate Beratung / Unterstützung
- Run@Rate Schulung / Coaching
Die Turtle-Methode ist ein einfaches, wirkungsvolles Tool zur Prozessanalyse und -beschreibung. Sie stellt Prozesse übersichtlich auf einer Seite dar und zeigt alle relevanten Infos. Auch Zertifizierungsauditoren nutzen sie häufig, etwa im Rahmen der ISO/TS 16949. Im Fokus stehen Kundenanforderungen (Input) und das gelieferte Ergebnis (Output).
Welche Informationen werden anhand der Turtle-Methodik ermittelt:
- Um welchen Prozess handelt es sich
- Wer ist der Prozessverantwortliche
- Was sind die Prozesseingaben (Inputs)
- Was sind die Prozessergebnisse (Outputs)
- Womit realisiere ich den Prozess (Equipment, Betriebsmittel, ...)
- Wer ist an dem Prozess beteiligt und welche Fähigkeiten sind notwendig
- Mit welchen Indikatoren wird der Prozess gemessen (z.B. Prozesskennzahlen)
- Wie wird der Prozess gesteuert (Prozessvorgaben und -standards)
- Welche Risiken bestehen für den betrachteten Prozess
Wofür kann die Turtle-Methode eingesetzt werden:
- Zur Darlegung eines Prozesses (Prozessmanagement)
- Zur Durchführung von Risikoanalysen (Kostenminimierung)
- Zur Durchführung von Prozessanalysen (Prozessoptimierung)
Tipps für die erfolgreiche Anwendung:
- Wählen Sie den Prozess aus, wo Sie derzeit am meisten Probleme haben oder das größte Verbesserungspotenzial sehen
- Führen Sie einen Workshop durch und binden Sie den Prozessverantwortlichen sowie die am Prozess beteiligten Funktionen ein
- Nutzen Sie für den Workshop Moderationsequipment (Moderationswand, Moderationskarten)
- Arbeiten Sie im Team die konkreten Verbesserungsmaßnahmen heraus und sorgen Sie für die Umsetzung
- Führen Sie einen Follow-Up-Workshop durch und bewerten Sie im Team die umgesetzten Maßnahmen auf Erfolg und Nachhaltigkeit
Unsere Dienstleistung zum Thema:
- Turtle-Methode Beratung / Unterstützung
- Turtle-Methode Tools Schulung / Coaching
Hinter TQM (Total Quality Management) verbirgt sich eine Managementphilosophie welche den Qualitätsgedanken in allen Bereichen einer Organisation in den Mittelpunkt rückt. Die TQM-Philosophie wurde zunächst in den USA verfolgt und später in Japan weiterentwickelt. Das Streben nach vollständiger Kundenorientierung mit Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualität steht ebenso im Fokus wie die kontinuierliche Verbesserung bisher erreichter Zustände.
Der TQM Grundgedanke:
„Total“ steht für „allumfassend“ oder „ganzheitlich“, d.h. alle Ebenen eines Unternehmens durchdringend, aber auch nach außen wirkend
„Quality“ steht für allumfassende Qualität d.h. Prozessqualität, Führungs- und Personalqualität, Qualität der Mitwelt- und Außenbeziehungen und selbstverständlich auch für Produktqualität
„Management“ steht für das Ausführen und die wertgerichtete Koordination der anstehenden Aufgaben unter Beachtung der Anforderungen wie Zeit, Kosten und Funktionen.
Die TQM Philosophie:
- Qualität orientiert sich am Kunden
- Qualität wird mit Mitarbeitern aller Bereiche und Ebenen erzielt
- Qualität ist kein Ziel, sondern ein Prozess, der nie zu Ende ist
- Qualität bezieht sich nicht nur auf Produkte, sondern auch auf Dienstleistungen
- Qualität setzt aktives Handeln voraus und muss erarbeitet werden
Umfassende Qualitätsarbeit (TQM) ist ein von der Leitung der Organisation unterstützter Prozess, der in der gesamten Organisation umgesetzt wird, mit dem Ziel der Optimierung des Organisationserfolges (vielleicht sogar „Excellence-Modell“).
Die gesamte Organisation will durch Einbindung aller Mitarbeiter:innen in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess bessere Ergebnisse zu erzielen.
Unsere Dienstleistung zum Thema:
- TQM Beratung / Unterstützung
- TQM Schulung / Coaching
Die DRBFM, eine Weiterentwicklung der FMEA bei Toyota, fokussiert auf das hohe Fehlerpotenzial bei Änderungen. Sie unterstützt die Entwicklung robuster Designs durch systematische Analyse und kreative Teamdiskussionen zu Produktänderungen. DRBFM ergänzt die FMEA, indem die gewonnenen Erkenntnisse zurück in die FMEA einfließen.
Definition
Die Abkürzung DRBFM steht für "Design Review Based on Failure Mode" und zeigt die wesentlichen Elemente im Vorgehen auf:
- DR = Design Review: Überprüfung der Entwicklung durch interne und externe Experten (Kunden, Zulieferer), die selbst nicht am Projekt beteiligt sind.
- BFM = Based on Failure Mode: Bedeutet einerseits, dass zum Zeitpunkt eines DRBFM-Meetings eine FMEA erstellt wurde. Des Weiteren bedeutet Based on Failure Mode auch, dass der Ursprung der DRBFM in der FMEA zu suchen ist. Der Erfinder der Methode, Prof. Dr. Tatsuhiko Yoshimura, versuchte zunächst die Ingenieure zu einem kreativen Design Review mittels eines FMEA-Formblattes zu überzeugen, musste aber feststellen, dass die Kreativität im Design Review durch den formellen Aufbau des FMEA-Formblattes nicht gegeben war.
Ziel der DRBFM-Methodik
- Produkt verändert
- Hohe Qualität beibehalten
- Neue Risiken im Rahmen der Produktänderung vermeiden
Vorgehen
- üblicherweise nicht mit Moderatoren wie bei der FMEA-Erarbeitung
- Jedoch sind technische Experten notwendig (max. 3-4 Teilnehmer)
- Einsatz bewährter Entwicklungs- und Qualitätswerkzeuge hilfreich
- Umsetzung erfolgt anhand realen Mustern (Produkten), auf einem Arbeitsblatt (DIN-A0-Format), sowie die Verwendung von Metaplan- und Moderationstechniken
Wichtige Tipps für die Anwendung der DRBFM:
- Exzellente Design Reviews sind das Schlüsselelement
- Lege den Fokus auf die geänderten Punkte
- Aktive Diskussionen und Vergleiche mit ähnlichen oder vorhergehenden Mustern / Modellen, um potentielle Probleme zu finden.
- Schnelle Umsetzung der Änderungen in den Zeichnungen
- Ergebnisse aus DRBFM in FMEA einfließen lassen
- Ergebnisse der DRBFM müssen sich in der Vorserie widerspiegeln
Unsere Dienstleistung zum Thema:
- DRBFM Beratung / Unterstützung
- DRBFM Schulung / Coaching
Die Messsystemanalyse (MSA) dient dazu, die vom Messsystem verursachte Streuung zu erkennen und von der Prozessstreuung zu unterscheiden. Da Messprozesse selbst variieren, setzt sich die gemessene Variation aus Prozess- und Messsystemabweichungen zusammen. Systematische Fehler verfälschen Ergebnisse, zufällige Fehler erhöhen die Unsicherheit. Deshalb muss vor Prozessfähigkeitsuntersuchungen die Eignung des Messsystems geprüft werden.
Phasen einer MSA - Messsystemanalyse
Nach dem Leitfaden der Automobilindustrie „Fähigkeitsnachweis von Messsystemen“
Phase 1
Auflösung des Messgerätes (≤ 5% der Toleranz des zu messenden Merkmals)
Phase 2
Messunsicherheit des Referenzteils / Normals
Phase 3a
Bestimmung der Linearität
Phase 3b (Verfahren 1)
Beurteilt die systematische Messabweichung und die Wiederholpräzision unter „idealisierten“ Bedingungen. Unter idealisierten Bedingungen versteht man in diesem Sinne; Messungen von nur einem Prüfer an einem Normal / Referenzteil.
Phase 4 (Verfahren 2)
Beurteilt die Wiederholbarkeit (Repeateability) und Reproduzierbarkeit (Reproduceability) mit Bedienereinfluss. Unter idealisierten Bedingungen versteht man in diesem Sinne, Messungen an mehreren Prüflingen, sowie mehrmalige Messungen von mehreren Prüfern.
Phase 4 (Verfahren 3)
Unterscheidet sich von Verfahren 2 dadurch, dass der Bedienereinfluss in der Analyse nicht berücksichtigt wird. Bei der Anwendung des Verfahrens muss jedoch sichergestellt sein, dass dieser vernachlässigbar gering ist, z.B. durch automatisches Einlegen der Teile oder Verwendung von Hilfsmitteln, welche den Einfluss der/des Bediener(s) minimieren.
Phase 5
Stabilität / Fortlaufende Überwachung der Messbeständigkeit.
Nominale oder ordinale Merkmale, bei denen eine physikalische Messung nicht möglich ist, werden subjektiv bewertet. In diesen Situationen ist es schwierig die Qualitätsmerkmale zu definieren.
Die Aufgabe von Prüfern besteht darin, diese Merkmale bestmöglich einzustufen. Die Prüfer-übereinstimmung wird verwendet, um die Übereinstimmung von mehreren Prüfern zu untersuchen. Beim Test auf Prüferübereinstimmung dürfen die Fehlermerkmale nicht mehrfach an einem Prüfling vorkommen. Um bedeutungsvolle Klassifizierungen der Prüflinge zu erhalten, sollten mindestens zwei Prüfer das Antwortmaß klassifizieren.
Beispiele für die Anwendung des Verfahrens für attributive Daten - Prüferübereinstimmung können sein:
- Bewertung von schriftlichen Prüfungsarbeiten
- Klassifizierung von Fertigprodukten als „gut“ oder „schlecht“
- Sichtkontrolle der Oberflächengüte von z.B. galvanisierten oder lackierten Teilen
- Einstufung von Geschmack, Farbe, Geruch, etc. von Getränken auf einer Skala von 1 bis 5
Unsere Dienstleistung zum Thema:
- MSA Beratung / Unterstützung
- MSA Schulung / Coaching
Die Reifegradabsicherung ist eine vom Kunden initiierte Projektsteuerung, die alle Beteiligten frühzeitig in den Produktrealisierungsprozess einbindet. Sie sorgt für eine strukturierte Qualitätsvorausplanung und ein systematisches, bereichsübergreifendes Vorgehen, das oft an fehlender Organisation oder Methodenkenntnis scheitert.
Anwendbar bei allen Neuteilen, wird je nach Risikoklasse das Zusammenarbeitsmodell festgelegt und Lieferumfänge zu Projektbeginn klassifiziert. So werden Inhalte und Abläufe harmonisiert, kritische Lieferumfänge erkannt und deren Status an Meilensteinen bewertet, wodurch Anlauf-, Anliefer- und Feldqualität verbessert werden.
Der Produktentstehungsprozess besteht nach VDA aus nachfolgenden Phasen:
- Konzeptions- und Einleitungsphase
- Vorentwicklungsphase
- Prototypenphase
- Pilotphase
- Serienphase
Über die Phasen hinweg steht eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit der Teammitglieder, welche Aufgabenstellungen parallel bearbeiten im Vordergrund.
Reifegradmeilensteine nach VDA:
- Innovationsfreigabe für Serienentwicklung
- Anforderungsmanagement für Vergabeumfang
- Festlegung der Lieferkette und Vergabe der Umfänge
- Freigabe technische Spezifikationen
- Produktionsplanung abgeschlossen
- Serienfallende Teile und Serienanlagen verfügbar
- Produkt- und Prozessfreigabe
- Projektabschluss, Verantwortungsübergabe an Serie, Start der Requalifikation
Umsetzung der Methode RGA:
Zu Beginn ist ein bereichsübergreifendes Team festzulegen. In der Regel besteht das Team aus Personen aus den Bereichen Produktmanagement, Entwicklung/Konstruktion, Beschaffung, Produktion, Logistik, Qualitätssicherung, ggf. ist auch die Einbindung von Lieferanten notwendig.
Die in der Reifegradabsicherung beschriebenen Bausteine sind durchzuführen. Die wichtigsten Aktivitäten sind hierbei:
- Ermittlung der kritischen Bauteile zur Ermittlung des kritischen Pfades und der Vorgehensweise in Empfehlung an die Reifegradabsicherung
- Für die Umsetzung der Maßnahmen muss die Festlegung der Verantwortlichkeit erfolgen.
- Es muss der Nachweis erbracht werden, dass die vereinbarten Maßnahmen wirksam und termingerecht umgesetzt wurden.
- Die Kommunikation der beteiligten Lieferanten erfolgt, vom Kunden ausgehend, in der Lieferkette. Ein unverzichtbares Element für die Anwendung der Reifegrad-Methode ist ein, über die Lieferkette vereinbartes, idealerweise standardisiertes Berichtswesen. Das ist ein Verfahren zur Festlegung und Überwachung von Korrekturmaßnahmen sowie ein Eskalationsvorgehen.
- Ebenen der Berichtserstattung über den Reifegrad-Status in der Lieferkette, werden beim „Start“ des Projekts festgelegt und sind abhängig von der Risikoeinstufung und den Kundenvorgaben.
- Der Kunde (Steuerkreis) gibt das Format und die Frequenzen für den Statusbericht und die definierten Ebenen der Lieferkette vor.
Wichtige Voraussetzungen damit die Umsetzung gelingt:
- Professionelles Projektmanagement
- Bereichsübergreifende Zusammenarbeit
- Phasenbezogene Freigabemechanismen
- Beherrschung von Problemlösungsmethoden
Unsere Dienstleistung zum Thema:
- Reifegradabsicherung Beratung / Unterstützung
- Reifegradabsicherung Schulung / Coaching
SPC (Statistische Prozesslenkung) bedeutet das Lenken und Regeln von Prozessen mit statistischen Methoden – nicht nur Prozesskontrolle. SPC überwacht Prozesse als Frühwarnsystem, erkennt Abweichungen früh, prüft Korrekturen, macht Prozesse transparent, sichert Stabilität und bewertet Prozessleistung und -fähigkeit.
Jeder Prozess zeigt natürliche Streuungen, die sein Verhalten im Normalzustand widerspiegeln und durch Umwelteinflüsse schwanken. Die Prozesslage wird von systematischen Einflüssen bestimmt. Ziel der Regelung ist, die Prozesslage so einzustellen, dass unter wirtschaftlichen Aspekten optimale Qualität entsteht. Die Prozessregelung lenkt und verbessert Prozesse basierend auf aktuellen Daten, unterstützt Entscheidungen zum Eingreifen und erkennt Änderungen in der Fertigungslage. Ziel ist die Streuungsreduktion zur Minimierung von Ausschuss und Nacharbeit – idealerweise Null Fehler. Der Nutzen liegt im präventiven Handeln durch Parameterkontrolle und deren Auswirkungen auf das Produkt.
Voraussetzung für Prozessverbesserung sind fähige Prüfmittel und genaue Prozessanalysen.
Unsere Dienstleistung zum Thema:
- SPC Beratung / Unterstützung
- SPC Schulung / Coaching
Benutzungsregel
Wir weisen darauf hin, dass wir mit der Möglichkeit Ihnen verschiedene Vorlagen zum Download anbieten eine Hilfestellung geben wollen. Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung ob die Tools und Vorlagen richtig funktionieren. Ggf. macht eine Gegendarstellung Sinn, z. B. der Berechnungsformeln in den Excel-Dateien über entsprechende Programme, wie ein CAQ-System oder eine Statistik-Software. Gerne stehen wir beratend zur Verfügung oder geben Ihnen Hilfestellung bei der Anwendung oder bei Fragen zu den Tools und Vorlagen. Bitte haben Sie weiterhin Verständnis, dass wir keine Garantien für diese Vorlagen übernehmen können und deshalb die Anwendung der Tools und Vorlagen und eventuelle Folgen daraus allein dem Anwender obliegen.
Wir bieten verschiedene Tools und Vorlagen zum kostenlosen Download und zur eigenen Nutzung an.
Kontaktieren Sie uns
schnell und einfach!
Unsere
Kontaktdaten
Omikron Consulting
Bleiben Sie mit uns in Kontakt: